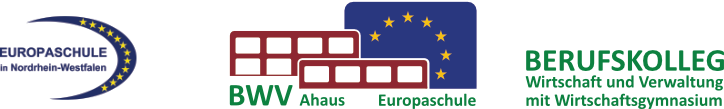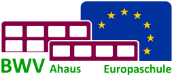Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie es sein kann, dass große Parteien Entscheidungen durchgehen lassen, die ihren Werten komplett widersprechen? Warum arten Debatten sowohl im Bundestag als auch im Europäischen Parlament oft aus? Die SIMEP (Simulation des Europäischen Parlaments), die am vergangenen Freitag und Samstag stattfand, gewährte 11 Mitgliedern unseres Europaclubs einen einzigartigen Einblick in den Alltag der MEPs (Members of the European Parliament), indem sie uns in die Rolle von Abgeordneten schlüpfen ließ. Das Ergebnis: mehr Verständnis für die Schwierigkeiten, die den Parlamentariern bei der Entscheidungsfindung begegnen.
Der Weg von der ersten Idee zum fertigen Entschluss ist im Europäischen Parlament berühmt und berüchtigt dafür, besonders lang zu sein. Das ist begründet in zahlreichen Aspekten. Auch in der SIMEP, einer Veranstaltung, deren Ergebnis keine echten Auswirkungen hat, wurde die Zeit in der finalen Plenumsdebatte stark überzogen, weil eine Einigkeit zwischen den Parteien kaum möglich schien. Aber bereits davor, in der Einarbeitungsphase, wurde viel Zeit verwendet – schließlich kann man keine guten Entscheidungen treffen, wenn man sich mit dem Thema kaum oder gar nicht auskennt. Uns Schüler*innen lagen zusätzlich zu den zwei Entscheidungsvorlagen auch noch drei Inhaltspapiere (EU allgemein, Demokratie in Europa, Beziehungen der EU zu China), sowie ein Länderpapier (in meinem Fall über Deutschland) vor, das über die Absichten und Einstellungen des jeweiligen Landes informierte. Dann kam noch das Fraktionspapier dazu. All diese Unterlagen – jede davon mehrseitig – mussten erst einmal ausführlich gelesen und verstanden werden. Erst danach war es überhaupt möglich, sich mit den eigentlichen Themen dieses SIMEP zu befassen. Ganz schön viel zu lesen also. Aber halb so schlimm, es war ja üppig Zeit, oder? Nun ja, nicht wirklich. Wie die „echten“ Politiker*innen standen auch wir unter großem Zeitdruck: innerhalb von zwei Tagen mussten Ländergruppensitzungen, 2 Fraktionssitzungen, Ausschusssitzungen, 2 Pressekonferenzen und eine Plenardebatte stattfinden. Kurz gesagt: auch im Schnelldurchlauf dauert es lang. Und jetzt denken wir nur einmal – bei den Abgeordneten im Europäischen Parlament ist es noch wichtiger, die richtigen Entscheidungen zu treffen, schließlich sind sie die Vertretung für ca. 448 Millionen Menschen, da würde man hoffen, dass sich die Damen und Herren ein wenig Zeit nehmen.

Ein weiterer oft kritisierter Aspekt des Europäischen Parlaments sind die hitzigen Debatten. Zweifellos haben auch Sie sich schon einmal gefragt, warum die Abgeordneten nicht einfach sachlich und professionell bleiben können – das ist doch schließlich ihr Beruf. Ich kann nun aus Erfahrung sprechen: sie ergeben sich irgendwie. Vermutlich liegt es daran, dass Politik so etwas unglaublich Persönliches ist und auch etwas, bei dem jeder davon überzeugt ist, die eigene Meinung sei die einzig richtige. Wenn nun also die EVP vorschlägt, man solle doch bitte den Absatz über die Einführung transnationaler Wahllisten für die Europawahlen streichen, weil es für Wähler*innen zu überfordernd sei, sich mit Kandidat*innen zu befassen, die außerhalb des eigenen Wahlkreises ansässig sind, rutscht einem vielleicht die ein oder andere provokative Frage wie „Wissen Sie eigentlich, wie Wahlen funktionieren?“ heraus. Und das ist noch harmlos! Als es darum ging, ob allen geflüchteten Uigur*innen in der EU Asyl gewährt werden sollte, flog zusätzlich zu durchdachten Redebeiträgen auch der Vorwurf des Antisemitismus durch die Luft. Die JEF hatten die Themen bewusst polarisierend gewählt und dies kam auch bei einer Debatte über die Festlegung von Geschlechterparität auf Wahllisten zum Vorschein. Wenn ein Abgeordneter die Sorge äußert, zahlenmäßige Gleichheit aller Geschlechter würde zu einer Verringerung der Anzahl an qualifizierten Abgeordneten führen, fällt es schwer sachlich zu bleiben. Auch Grimassen, provokative Handbewegungen und sogar „Buh!“-Rufe fanden ihren Weg in den Plenarsaal. Im Nachhinein fragt man sich zwei Dinge: „War das wirklich ich?“ Und: „Wo bekomme ich jetzt am schnellsten eine Kopfschmerztablette her?“
Nun aber zurück zu meiner Eingangsfrage: Wie kann es eigentlich sein, dass eine große Partei ihre Werte nicht durchsetzen kann? Wählen wir der Einfachheit halber als Beispiel hierfür die S&D. Die S&D möchte, wie oben schon erwähnt, die Geschlechterparität auf Wahllisten festlegen. Alle anderen Fraktionen sind dagegen. Ohne eine Koalition (also eine Verbündung mit einer oder mehreren anderen Parteien) ist das nicht möglich. Selbst die EVP, die größte Fraktion im Europäischen Parlament, kann das nicht, sie macht gerade einmal einen Anteil von ca. 24% der Abgeordneten aus. Will man also etwas erreichen, muss eine Einigung her. Für diese Einigungen müssen oft schmerzhafte Kompromisse eingegangen werden. Die Fraktionen müssen sich ganz klar sein, wie sie ihre Prioritäten setzen, denn alles, was man sich wünscht, bekommt man nie. Das ist in der Politik so wie im echten Leben.
Wenn Sie sich also nächstes Mal über „die da oben“ ärgern, überlegen Sie einfach mal, ob Sie nicht ein wenig Empathie walten lassen können. Wir wollen ja auch, dass es andersherum so ist.
Ein Artikel von Simone Olbrich